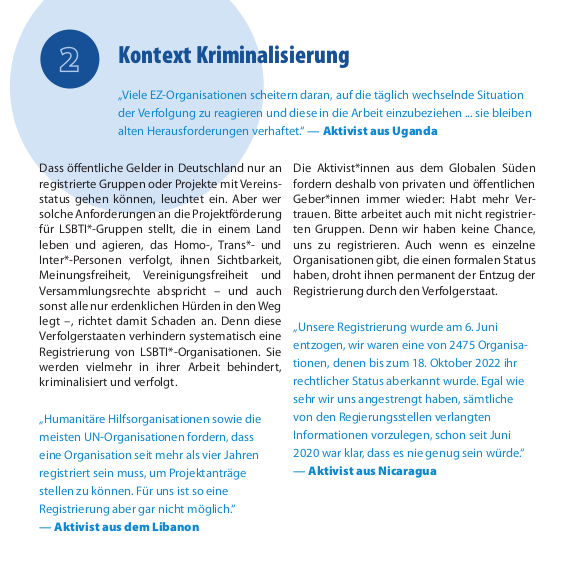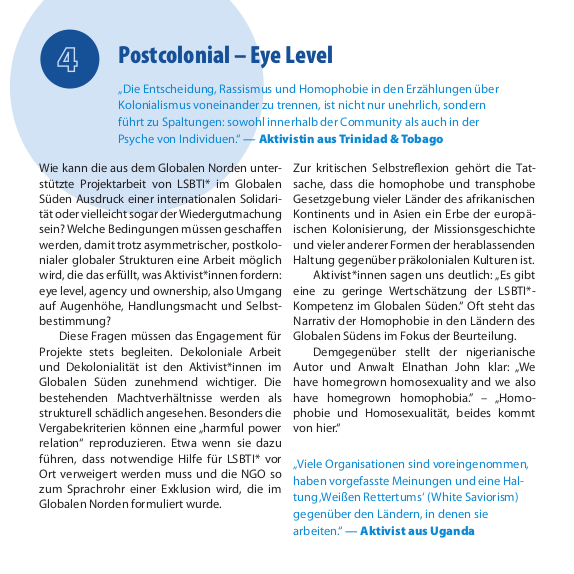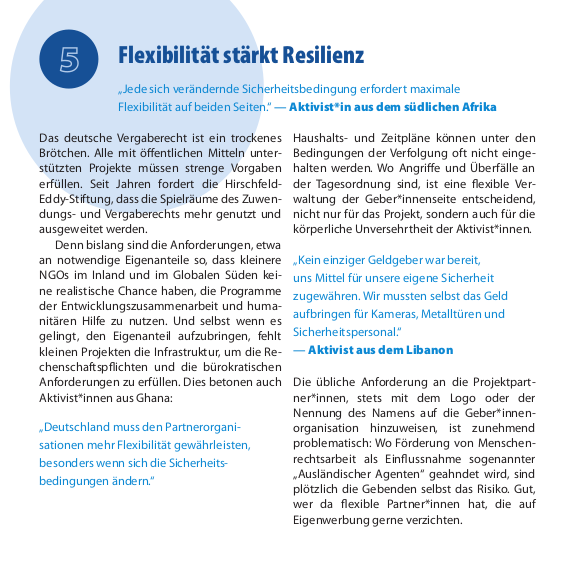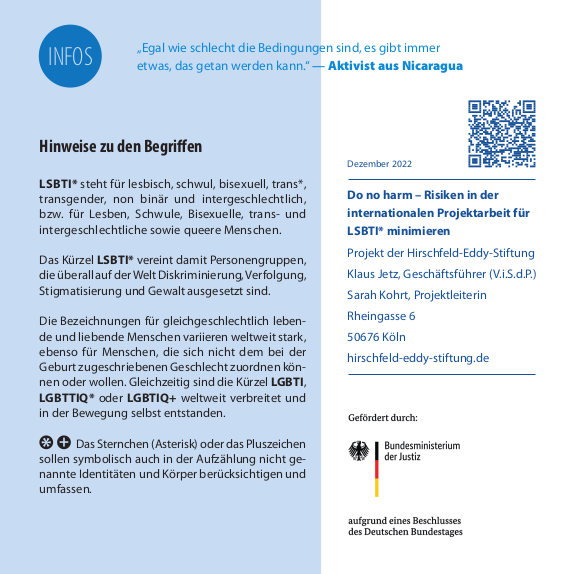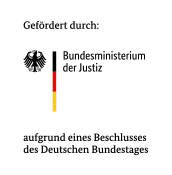Download und kostenlose Bestellung hier Leporello, 14,9 x 14,9 cm, 10 Seiten
Do no harm, but do something
Wo sich staatliche oder private Geber*innen für die Unterstützung von Freiheit und Menschenrechten engagieren, besteht immer auch die Gefahr, dass die Hilfe am Ende mehr Schaden als Nutzen anrichtet.
Das ist die Erkenntnis, die im Prinzip „Do no harm“ pointiert zusammengefasst wird. Was gut gemeint ist, ist nicht immer auch gut gemacht. „Do no harm“ (richte keinen Schaden an) ist die Aufforderung, genau hinzusehen.
Die internationale Menschenrechtsarbeit muss immer von einer umfassenden Risikoanalyse begleitet werden – und das in allen Phasen eines Projektes: beginnend bei der Konzeption, über die gesamte Zeit der Durchführung bis zur Evaluation.
Hilfe kann Schaden anrichten – aber die Sorge darum darf nicht zu Untätigkeit führen. Wir möchten private und staatliche Geber*innen ausdrücklich ermuntern, Projekte zum Empowerment, für Advocacy und zur Unterstützung von LSBTI*-Menschenrechtsverteidiger*innen zu initiieren, weiterzuführen und immer wieder zu verbessern.
Deshalb haben wir sieben Aspekte für eine umsichtige internationale Projektarbeit mit LSBTI* zusammengestellt. Diese sind das Ergebnis von Fach- und Hintergrundgesprächen zwischen Aktivist*innen aus dem Globalen Süden und Norden aus einem Jahr Projektarbeit zum Thema „Do no harm – Risiken in der internationalen Projektarbeit für LSBTI* minimieren“.
Die einfachste Regel ist: Die Expertise liegt vor Ort. Deshalb fokussieren wir uns hier darauf, was unsere Projektpartner*innen im Globalen Süden im Sinn des Ansatzes „Do no harm“ für queere Projekte besonders wichtig finden.
Unser Engagement basiert auf der Erfahrung, dass eine von Geber*innen aus dem Globalen Norden finanzierte Menschenrechtsarbeit für LSBTI* notwendig ist und weiter verstärkt werden muss. Für LSBTI*-Projekte bedeutet bereits das Nichtstun, Schaden anzurichten. In einer Situation, in der Verfolgung verbreitet ist, muss etwas getan werden, um die alltägliche Diskriminierung und den daraus resultierenden Schaden zu stoppen. Oder wie auch unsere Projektpartner*innen immer wieder sagen: Do no harm, but do something.
Blog-Artikel:
- Do no harm – Was heißt das für LSBTI-Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit?
- Do no harm – but do something. Input zum Kickoff in Berlin
- Do no harm – Schadensbegrenzung in der Entwicklungszusammenarbeit mit LGBTIQ-Organisationen. Hintergründe und Umsetzung in der zivilen Friedens- und Konfliktarbeit.
- “Multiplying voices”: Doing no (more) harm to our LGBTIQ+ community in Central America: Lessons learned.
Das Wissen vor Ort erfragen, Projekte von unten entwickeln
„Aber viele dieser Initiativen entstammen der Logik von Interventionen, die von oben nach unten ausgerichtet sind und die nicht anerkennen, dass es einen Erfahrungsschatz sozialer Strategien gibt, die Menschen aus der LSBTI*-Gemeinschaft entwickelt haben.“
Aktivistin* aus Kolumbien
Was vor Ort gebraucht wird, ist am besten vor Ort zu erfahren. Die regionalen LSBTI*-Projekte wissen selbst am besten, welche Risiken es gibt, worin sie genau bestehen, und wie die Arbeit geleistet werden kann ohne die Beteiligten zusätzlichen Gefahren für Leib und Leben auszusetzen.
Tausende Kilometer entfernt, vielleicht sogar von einem anderen Kontinent aus, kann eine Lagebeurteilung niemals gut sein, sondern bedarf der Informationen, die von den Projektpartner*innen kommen. „Do no harm“ heißt also: Haben Sie Vertrauen in die selbstständige Arbeit der Aktivist*innen. Das notwendige Wissen ist bereits in den Communities vorhanden. Nur dort ist die Expertise. Es ist oft informell und als individuelles oder kollektives Erfahrungswissen nur durch Gespräche erfahrbar. LSBTI* in den Gruppen und Projekten vor Ort kennen die Risiken ihres Engagements – und auch die Schlupfwinkel – am besten.
Die Geber*innenseite muss ganz gezielt nach Risiken und Problemen fragen. Sonst kann das strukturell asymmetrische Verhältnis dazu führen, dass die Geber*innen Gefahren nicht sehen, sie herunterspielen oder verdrängen.
Entsprechend sollten bereits die Konzepte der Förder-Programme mit den lokalen Partner*innen entwickelt werden. Und nicht zuletzt sollte auch eine In-house-Sensibilisierung für die Situation von LSBTI* durch die lokalen Projektpartner*innen erfolgen.
„Wichtig ist, in jeder Gemeinschaft Verantwortliche zum Risikomonitoring einzusetzen.“
Aktivist aus Nicaragua
Blog-Artikel:
- Listen Closely – Act Carefully: Even with the Best Intentions in the World, We Can Sometimes Get It Wrong
- Wie gelingen gute und nachhaltige Projekte mit und für LSBTI in Lateinamerika? Erfahrungen aus zehn Jahren vorbildlicher Projektarbeit in Nicaragua
- Mehr Horizontalität in der Kooperation. Erfolgreiche Projekte von und für LSBTIQ+ in Lateinamerika
Kontext Kriminalisierung
„Viele EZ-Organisationen scheitern daran, auf die täglich wechselnde Situation der Verfolgung zu reagieren und diese in die Arbeit einzubeziehen … sie bleiben alten Herausforderungen verhaftet.“ Aktivist aus Uganda
Dass öffentliche Gelder in Deutschland nur an registrierte Gruppen oder Projekte mit Vereinsstatus gehen können, leuchtet ein. Aber wer solche Anforderungen an die Projektförderung für LSBTI*-Gruppen stellt, die in einem Land leben und agieren, das Homo‑, Trans*- und Inter*-Personen verfolgt, ihnen Sichtbarkeit, Meinungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit und Versammlungsrechte abspricht – und auch sonst alle nur erdenklichen Hürden in den Weg legt –, richtet damit Schaden an. Denn diese Verfolgerstaaten verhindern systematisch eine Registrierung von LSBTI*-Organisationen. Sie werden vielmehr in ihrer Arbeit behindert, kriminalisiert und verfolgt.
Die Aktivist*innen aus dem Globalen Süden fordern deshalb von privaten und öffentlichen Geber*innenn immer wieder: Habt mehr Vertrauen. Bitte arbeitet auch mit nicht registrierten Gruppen. Denn wir haben keine Chance, uns zu registrieren. Auch wenn es einzelne Organisationen gibt, die einen formalen Status haben, droht ihnen permanent der Entzug der Registrierung durch den Verfolgerstaat.
„Unsere Registrierung wurde am 6. Juni entzogen, wir waren eine von 2475 Organisationen, denen bis zum 18. Oktober 2022 ihr rechtlicher Status aberkannt wurde. Egal wie sehr wir uns angestrengt haben, sämtliche von den Regierungsstellen verlangten Informationen vorzulegen, schon seit Juni 2020 war klar, dass es nie genug sein würde.“
Aktivist aus Nicaragua
„Humanitäre Hilfsorganisationen sowie die meisten UN-Organisationen fordern, dass eine Organisation seit mehr als vier Jahren registriert sein muss, um Projektanträge stellen zu können. Für uns ist so eine Registrierung aber gar nicht möglich.“
Aktivist aus dem Libanon
Blog-Artikel:
Sichtbarkeit ist auch ein Risiko
„Je sichtbarer wir sind, desto größer ist auch die Ablehnung und Diskriminierung, die wir erfahren.“
Aktivist aus Nicaragua
„Der Sichtbarkeit und Gleichheit von lesbischen Frauen verpflichtet“, heißt es im Gründungspapier der Coalition of African Lesbians (CAL). Mehr Sichtbarkeit – weltweit können sich lesbische Frauen oft auf diese politische Zielsetzung verständigen.
„Das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Die lesbischen und queeren Frauen haben ihre Stimmen verstärkt und stehen in den sozialen und demokratischen Bewegungen ihrer Länder an vorderster Front.“
Aktivistin aus Südafrika
Aber in vielen Ländern der Welt ist Sichtbarkeit auch eine große Gefahr. Dort wo LSBTI* nicht willkommen sind, verfolgt und diskriminiert werden, geraten diejenigen in Gefahr, die sich öffentlich bekennen, deren Fotos gezeigt oder deren Namen genannt werden. Da kann schon die Anforderung von Geber*innen, eine Teilnehmendenliste für eine Veranstaltung zu erstellen, zu einem Outing mit schlimmen Folgen führen.
„Sichtbarkeit hat ganz unterschiedliche Formen und Ausprägungen.” Aktivist*in aus Ägypten
Ein positives Beispiel für umsichtige Projektarbeit ist das queere Filmfestival in Tunesien, dessen Ziel ist, Sichtbarkeit durch Artivism (Aktivismus mit Kunst) zu stärken, aber gleichzeitig die mit dem individuellen Outing verbundenen Risiken so gering wie möglich zu halten. Deshalb wird immer darauf geachtet, keine Fotos mit Gesichtern zu zeigen, keine Klarnamen zu nennen und auch den Veranstaltungsort nur in geschützten Gruppen bekannt zu geben.
„Artivism ist ein mächtiges Werkzeug, um feindselige Einstellungen gegen unsere Community zu bekämpfen, und es ist eine schöne, andere und mächtige Art, das Bewusstsein für mehr LGBTIQ-Akzeptanz zu schärfen.”
Aktivist aus Tunesien
Blog-Artikel:
Postcolonial – Eye Level
„Die Entscheidung, Rassismus und Homophobie in den Erzählungen über Kolonialismus voneinander zu trennen ist nicht nur unehrlich, sondern führt zu Spaltungen: sowohl innerhalb der Community als auch in der Psyche von Individuen.“
Aktivistin aus Trinidad & Tobago
Wie kann die aus dem Globalen Norden unterstützte Projektarbeit von LSBTI* im Globalen Süden Ausdruck einer internationalen Solidarität oder vielleicht sogar der Wiedergutmachung sein? Welche Bedingungen müssen geschaffen werden, damit trotz asymmetrischer, postkolonialer globaler Strukturen eine Arbeit möglich wird, die das erfüllt, was Aktivist*nnen fordern: eye level, agency und ownership, also Umgang auf Augenhöhe, Handlungsmacht und Selbstbestimmung?
Diese Fragen müssen das Engagement für Projekte stets begleiten. Dekoloniale Arbeit und Dekolonialität ist den Aktivist*innen im Globalen Süden zunehmend wichtiger. Die bestehenden Machtverhältnisse werden als strukturell schädlich angesehen. Besonders die Vergabekriterien können eine „harmful power relation“ reproduzieren. Etwa wenn sie dazu führen, dass notwendige Hilfe für LSBTI* vor Ort verweigert werden muss und die NGO so zum Sprachrohr einer Exklusion wird, die im Globalen Norden formuliert wurde.
Zur kritischen Selbstreflexion gehört die Tatsache, dass die homophobe und transphobe Gesetzgebung vieler Länder des afrikanischen Kontinents und in Asien ein Erbe der europäischen Kolonisierung, der Missionsgeschichte und vieler anderer Formen der herablassenden Haltung gegenüber präkolonialen Kulturen ist.
Aktivist*innen sagen uns deutlich: „Es gibt eine zu geringe Wertschätzung der LSBTI*-Kompetenz im Globalen Süden.“ Oft steht das Narrativ der Homophobie in den Ländern des Globalen Südens im Fokus der Beurteilung.
Demgegenüber stellt der nigerianische Autor und Anwalt Elnathan John klar: „We have homegrown homosexuality and we also have homegrown homophobia.” – „Homophobie und Homosexualität – beides kommt von hier.“
„Viele Organisationen sind voreingenommen, haben vorgefasste Meinungen und eine Haltung Weißen Rettertums (White Saviorism) gegenüber den Ländern, in denen sie arbeiten.“ Aktivist aus Uganda
Blog-Artikel:
- Do no harm? Reflections on the feminist and decolonial approach on harmful power relations. Shift to a culture of listening to local partners
- „Knüpft Beziehungen“. Einstieg in die dekoloniale Projektpraxis: das Masakhane-Projekt
- Factsheet: Für eine postkoloniale Praxis in der Entwicklungszusammenarbeit
- https://blog.lsvd.de/do-no-harm-reflections-on-the-feminist-and-decolonial-approach-on-harmful-power-relations/#more-21664
- https://www.hirschfeld-eddy-stiftung.de/schriften/factsheet-03-fuer-eine-postkoloniale-praxis-in-der-entwicklungszusammenarbeit
Flexibilität stärkt Resilienz
Das deutsche Vergaberecht ist ein trockenes Brötchen. Alle mit öffentlichen Mitteln unterstützten Projekte müssen strenge Vorgaben erfüllen. Seit Jahren fordert die Hirschfeld-Eddy-Stiftung, dass die Spielräume des Zuwendungs- und Vergaberechts mehr genutzt und ausgeweitet werden. Denn bislang sind die Anforderungen, etwa an notwendige Eigenanteile so, dass kleinere NGOs im Inland und im globalen Süden keine realistische Chance haben, die Programme der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe zu nutzen. Und selbst wenn es gelingt, den Eigenanteil aufzubringen, fehlt kleinen Projekten die Infrastruktur, um die Rechenschaftspflichten und die bürokratischen Anforderungen zu erfüllen.
Dies betonen auch Aktivist*innen aus Ghana: „Deutschland muss den Partnerorganisationen mehr Flexibilität gewährleisten, besonders wenn sich die Sicherheitsbedingungen ändern.“
Haushalts- und Zeitpläne können unter Bedingungen der Verfolgung oft nicht eingehalten werden. Wo Angriffe und Überfälle an der Tagesordnung sind, ist eine flexible Verwaltung der Geber*innenseite entscheidend nicht nur für das Projekt, sondern auch für die körperliche Unversehrtheit der Aktivist*innen.
„Kein einziger Geldgeber war bereit, uns Mittel für unsere eigene Sicherheit zu gewähren. Wir mussten selbst das Geld aufbringen für Kameras, Metalltüren und Sicherheitspersonal.“
Aktivist aus dem Libanon
Die übliche Anforderung an die Projektpartner*innen, stets mit dem Logo oder der Nennung des Namens auf die Geber*innenorganisation hinzuweisen, ist zunehmend problematisch: Wo Förderung von Menschenrechtsarbeit als Einflussnahme sogenannter „Ausländischer Agenten“ geahndet wird, sind plötzlich die Gebenden selbst das Risiko. Gut, wer da flexible Partner hat, die auf Eigenwerbung gerne verzichten.
„Jede sich verändernde Sicherheitsbedingung erfordert maximale Flexibilität auf beiden Seiten“.
Aktivist*in aus dem südlichen Afrika
Blog-Artikel:
- Zwischen Bürokratie und dekolonialem Anspruch: Das Masakhane-Projekt
- Factsheet: MASAKHANE. Empfehlungen für künftige LSBTIQ-Projekte
Existenzen sichern: Core Funding
„Ein tolles Projekt, das sehr wirksam ist.“ – so etwas hören alle gern, gerade die Geber*innen. Aber genau da gibt es Risiken: Ein großes Problem ist, dass nur zeitlich eng begrenzte Projekte gefördert werden.
Das Projektende kann zur existenziellen Bedrohung und zu einem Sicherheitsrisiko werden. Plötzlich brechen die finanziellen Mittel weg und wo eben noch die Aufmerksamkeit (der Geber*innen) die Aktivist*innen geschützt haben mag, sind sie jetzt auf sich allein gestellt.
Wichtig und risikominimierend wäre es, die Aktivist*innen nicht nur über einen kurzen Projektzeitraum, sondern auch langfristig abzusichern, das heißt institutionelle Förderung, (engl. Core Funding) zu ermöglichen. „Do no harm“ bedeutet in diesem Zusammenhang, sich klarzumachen: Wer einmal out ist, muss sich auch nach dem Ende eines Projektes schützen können.
Gerade bei Vorzeigeprojekten mit großer öffentlicher Aufmerksamkeit ist die Gefahr am größten, dass die Aktivist*innen erst exponiert und nach dem Ende der Projektförderung prekär zurückgelassen werden. Entsprechende Rückmeldungen erhalten wir auch von Lesbenprojekten aus dem südlichen Afrika hören ebenso wie von Transprojekten aus Lateinamerika: „Die Geber*innen müssen auf Core-Funding umstellen“ oder „Projektarbeit hat für uns zu viele Risiken. Nachhaltige Menschenrechtsarbeit muss langfristig ausgelegt sein.“
„Hilfreich ist Core-Funding – mehr in Richtung institutionelle Förderung. Das heißt, die Organisation insgesamt zu unterstützen und nicht nur ein Projekt innerhalb der Organisation – aber nicht mit so vielen Hürden.“
Aktivistin aus Namibia
Blog-Artikel
- Mehr Flexibilität für Nord-Süd-Projektförderung — Projekte für lesbische und indigene Frauen in Namibia
- https://blog.lsvd.de/good-practice-in-der-nord-sued-projektfoerderung-feministisch-flexibel-nachhaltig-webtalk-mit-liz-frank-womens-leadership-centre-namibia/
- RFSL in Schweden unterstützt Core Funding
Armut ist eine ständige Bedrohung – intersektional denken
Auch für LSBTI* gilt: Es ist einfacher klarzukommen, wenn man reich ist. Begrenzte finanzielle Mittel führen dagegen gerade bei denen, die wegen ihrer Lebensform sozial geächtet und vielleicht sogar strafrechtlich verfolgt werden, zu starken persönlichen Belastungen. Wenn sich LSBTI* um das nackte Überleben kümmern müssen und humanitäre Hilfe brauchen, wie das viele NGOs in der Covid-Pandemie erlebt haben, ist es zynisch zu verlangen, dass die Ressourcen nur wie beantragt für Advocacy-Arbeit genutzt werden. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Gesundheitsleistungen stehen in einer Krise an erster Stelle, wie die Covid-Pandemie deutlich gezeigt hat.
„Seit Anfang 2020 sind die Leute zu uns gekommen, weil sie um Hilfe zur Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse gebeten haben.“
Aktivist aus dem Libanon
„Traurigerweise haben weder örtliche noch internationale Geldgeber*innen humanitäre Hilfe mit Bargeld-Auszahlungen in ihren Projektanträgen vorgesehen. Sie haben auch keine nachhaltigen Programme vorgesehen wie Schutzräume, Zentren für Lebensmittel oder für eine LSBTI-inklusive Gesundheitsversorgung.“
Aktivist aus dem Libanon
Soziale Ächtung, strafrechtliche Verfolgung aber auch prekäre ökonomische Verhältnisse machen LSBTI* zu einer höchst vulnerablen Gruppe und das heißt im Alltag: Sie gehören immer auch zu denen, die von Programmen gegen Armut, zur Verbesserung öffentlicher Gesundheitsleistungen und für Schul- und Ausbildung profitieren. Deshalb ist es auch überhaupt nicht im Sinne dieser Gruppe, wenn gefordert wird, Entwicklungshilfe zu streichen.
Und vollständig lebensbedrohlich für LSBTI* wird es, wenn wohlmöglich auch noch versucht wird, diesen Entzug von Hilfe damit zu rechtfertigen, dass Homosexuelle in dem Land verfolgt werden, denn damit macht man sie öffentlich zu Sündenböcken.
„Das Problem mit Forderungen nach Streichung der Entwicklungszusammenarbeit ist, dass wir dann die Probleme bekommen, die Aktivist*innen. Wir sind dann die Sündenböcke.“
Aktivist aus Uganda
LSBTI* leben oft in existentiell bedrohlichen Situationen. Und eines ist klar: Leuten in Not die Hilfe zu verweigern, wird in der Regel furchtbar negative Konsequenzen haben.
Blog-Artikel:
- „Du bist doch normal – Warum holst du diese Personen aus ihren Löchern?“ Die Autorin und Aktivistin Trifonia Melibea Obono über die Lage von LSBTIQ+ in Äquatorialguinea
- Humanitäre Hilfe für LGBTIQ-Menschen auf der Flucht: Humanitäre Hilfe darf LSBTI nicht außen vorlassen
Infos
„Egal wie schlecht die Bedingungen sind, es gibt immer etwas, das getan werden kann.“ Aktivist aus Nicaragua
Hinweise zu Begriffen
LSBTI* steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, transgender, non binär und intergeschlechtlich, bzw. für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie queere Menschen.
Das Kürzel LSBTI* vereint damit Personengruppen, die überall auf der Welt Diskriminierung, Verfolgung, Stigmatisierung und Gewalt ausgesetzt sind.
Die Bezeichnungen für gleichgeschlechtlich lebende und liebende Menschen variieren weltweit stark. Ebenso für Menschen, die sich nicht dem bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht zuordnen können oder wollen. Gleichzeitig sind die Kürzel LSBTI, LSBTTIQ* oder LGBTIQ+ weltweit verbreitet und in der Bewegung selbst entstanden.
* Das Sternchen (Asterisk) oder das Pluszeichen sollen symbolisch auch in der Aufzählung nicht genannte Identitäten und Körper berücksichtigen und umfassen.
Dieser Text ist als Leporello veröffentlicht und kostenlos digital und gedruckt erhältlich. Faltblatt gefalzt, 14,9 x 14,9 cm, 10 Seiten, 4‑Farb-Druck, deutschsprachig.
Download (PDF) und kostenlose Bestellung hier:
„Do no harm – Risiken in der internationalen Projektarbeit für LSBTI* minimieren“
Projekt der Hirschfeld-Eddy-Stiftung
Klaus Jetz (Geschäftsführung)
Sarah Kohrt (Projektleitung)
Rheingasse 6
50676 Köln
Dezember 2022
www.hirschfeld-eddy-stiftung.de
Projektwebsite:
https://www.hirschfeld-eddy-stiftung.de/infozentrum/projekt-2022-do-no-harm/projekt-do-no-harm-projektbeschreibung
Ein Beitrag der Hirschfeld-Eddy-Stiftung im Rahmen des Projekts: „Do no harm – Risiken für LSBTI in der internationalen Projektarbeit minimieren“. Alle Beiträge im Rahmen des Projekts sind im Blog unter dem Tag „DNH-2022“ zu finden.